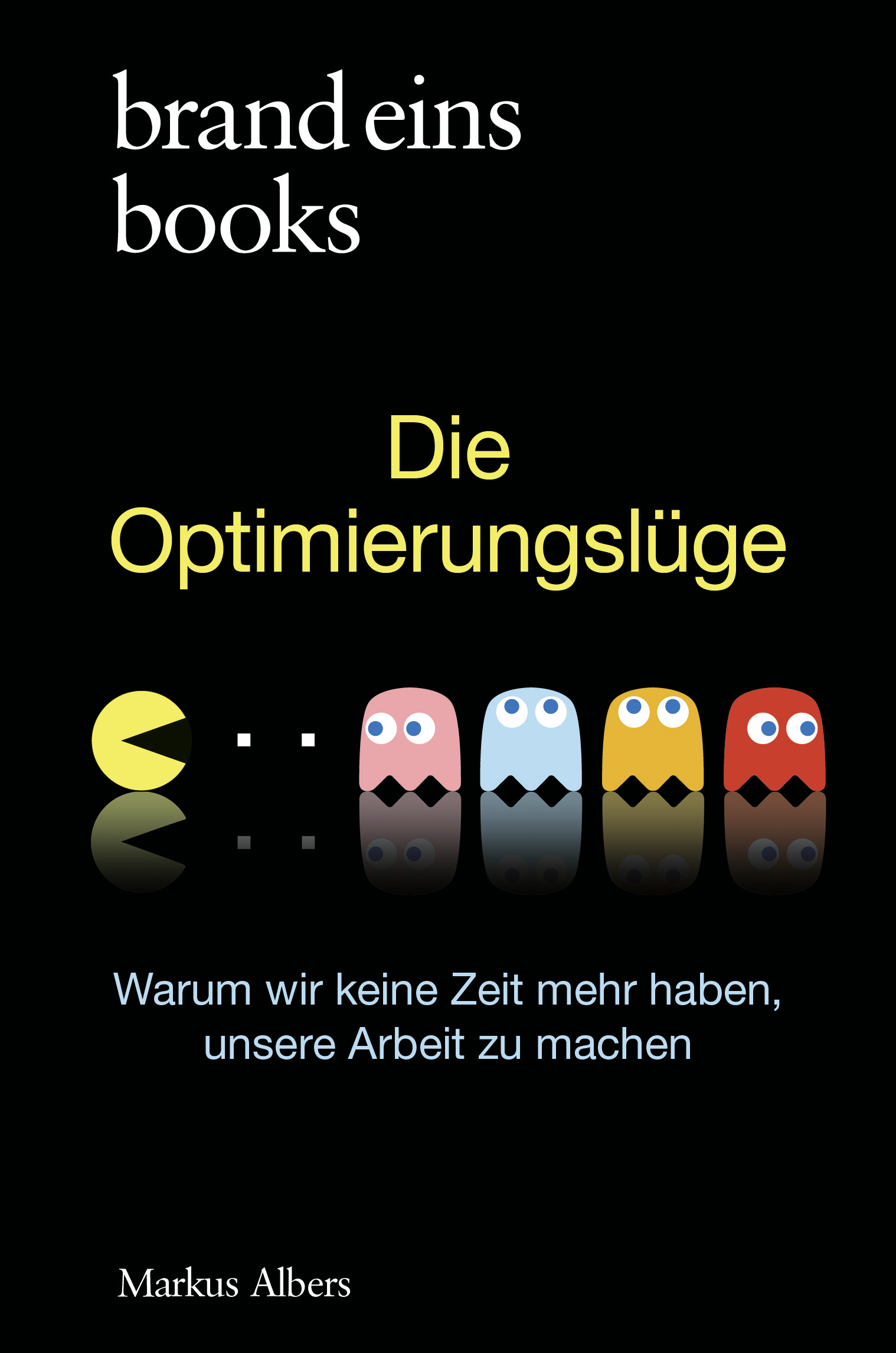Die Verfechter der ersten Theorie scheinen mir bei den meisten Gesprächen in der Überzahl zu sein, und sie sind sich sicher: Gemeinsam im Konfi sitzen und brainstormen, auf dem Whiteboard Einfälle skizzieren, sich im Großraum Geistesblitze hin- und herspielen – natürlich klappt das besser, als so einen spontanen Austausch mühsam per Teams, Slack oder Miro nachzustellen.
Eine Minderheit, zu der ich gehöre, ist sich da nicht so sicher. Ja, auch mir macht es Spaß, mit Menschen im selben Raum Gedanken-Pingpong zu spielen. Zugleich weiß ich, dass ich mit Teammitgliedern, Kunden und Partnern, die teils weit entfernt vor ihren Bildschirmen sitzen, eben doch extrem produktive Kreativprozesse in Gang setze. Manchmal sind sie sogar qualitativ hochwertiger. Warum?
1. Weil online auch die Schüchternen zu Wort kommen, die sich zwischen lauter extrovertierten Kollegen sonst nicht trauen.
2. Weil die zeitversetzte Natur digitaler Kollaboration eher der Art und Weise entspricht, wie Ideen überhaupt entstehen. Wir haben unsere besten Einfälle nicht auf Befehl und unter Druck im Meeting. Sondern auf dem Rad, unter der Dusche, beim Salat-schnippeln. Wie oft fallen uns die schlagfertigsten Antworten, die besten Beiträge zu einer Diskussion hinterher ein, wenn es zu spät ist? Asynchrone Kreation mittels Online-Tools gibt uns genau diese Chance, kurz nachzudenken, das Gehörte zu verarbeiten und mit einem originellen Vorschlag in die Diskussion zurückzukommen.
Beides – die Inklusion der Zurückhaltenden und die Nachdenkzeit – bringen bessere kreative Ergebnisse hervor, wie verschiedene Untersuchungen belegen. Es könnte also alles gut sein, oder? Warum haben wir dann trotzdem das Gefühl, kaum noch Zeit für neue Einfälle zu haben? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst von Vorurteilen verabschieden, wie Ideen entstehen. Forscher haben nämlich ziemlich genau untersucht, wie der typische Kreativprozess aussieht, also Neues in die Welt kommt.
In diesen Arbeiten hat sich gezeigt: Es ist keine Frage von entweder/ oder, sondern es braucht beides: Austausch und Abstand, Energie und Einsamkeit. Die Wissenschaft definiert den kreativen Prozess heute als sechs aufeinanderfolgende Phasen: Wir beginnen mit der Orientierung, in der wir mit großer Neugierde Informationen sammeln. Dann folgt die Phase der Inkubation, in der wir das zu lösende Problem definieren und unter Verwendung der vorher gesammelten Informationen nach Lösungen suchen – dies kann bewusst oder unbewusst geschehen. In der dritten Phase, der Illumination, erlebt der kreative Mensch, so der Kreativitätsexperte Mark Runco, „divergentes Denken, Offenheit und Aufregung“.
Während der Verifikation wird die eigene kreative Arbeit bewertet und mit existierenden Ansätzen verglichen. Schließlich folgen mit der Kommunikation und der Validation jene Phasen, in denen die neue kreative Schöpfung zunächst anderen – Expertinnen, Kollegen, Freundinnen, sowie schließlich der gesamten Öffentlichkeit – zugänglich gemacht, von außen bewertet und dann entweder angenommen oder abgelehnt wird.
Kreativität hat also scheinbar widersprüchliche Voraussetzungen: Zurückgezogenheit und Kommunikation, einsames Denken und äußerer Input, Ruhe und öffentliche Diskussion. Weder stimmt in der Regel das Klischee des einsamen Genies, das in der Isolation seine größten Werke schafft. Noch kann unter dem täglichen Dauerfeuer von Ablenkung wirklich Neues entstehen. Wer kreativ sein will, braucht abwechselnde Phasen intensiver Informationsaufnahme, einsamer Kontemplation und kommunikativer Auseinandersetzung.
Aber wenn es in der neuen Arbeitswelt an einem mangelt, dann ist das Konzentration. Oder gar Kontemplation. Wann hast du das letzte Mal aus dem Fenster in die Wolken geschaut und ungesteuert die Gedanken fliegen lassen? Also: länger als zehn Sekunden, ohne dass ein PING! dich aus den Gedanken riss? Eben. Könnte es also sein, dass die permanente digitale Kommunikation uns der Fähigkeit beraubt, kreativ zu sein? Und damit auch die Voraussetzungen erodiert, Neues in die Welt zu bringen?
Es wird offenbar immer schwieriger, neue Ideen zu finden. Das hat verschiedene Gründe: Einerseits gibt es immer weniger grundlegende Entdeckungen zu machen – das Rad oder die Genomsequenzierung kann man nur einmal erfinden. Und dort, wo sich doch noch Neues versteckt, ist dieses immer schwerer zu finden. Der amerikanische Ökonom Tyler Cowen behauptet seit vielen Jahren, dass die Menschheit bei ihren Entdeckungen möglicherweise alle niedrig hängenden Früchte bereits gepflückt hat. Sein Kollege Robert J. Gordon spottete bereits 2011 über damals aktuelle technische Errungenschaften: Keine davon sei auch nur annähernd so wichtig fürs menschliche Wohlergehen wie die Toilette.
Der radikale Wandel und das schnelle Wachstum, die durch die Innovationen des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden sind, bleiben heute weitgehend aus. „Wir wollten fliegende Autos“, so ein Internet-Meme, das dem Investor Peter Thiel zugeschrieben wird, „stattdessen bekamen wir 140 Zeichen“ – gemeint ist das damalige Textlimit der Social-Media-Plattform Twitter.
Wenn es heute also eh schon schwieriger als früher ist, innovativ zu sein, warum machen wir es uns dann zusätzlich schwer? Wissenschaftler der University of Chicago analysierten, wie sich der Alltag in einem IT-Unternehmen durch hybrides Arbeiten verändert hat. Ergebnis: Die Arbeitstage waren länger, aber die Mitarbeitenden hatten trotzdem weniger Zeit, sich zu konzentrieren, als früher. Die gesamte zusätzliche Arbeitszeit wurde durch Besprechungen ausgefüllt. „Die eigentliche Quelle der Ineffizienz war – Überraschung – die in Meetings verbrachte Zeit“, kommentiert das Nachrichtenmagazin The Economist.
Um herauszufinden, ob uns das auch weniger innovativ macht, spreche ich mit Mark Runco, dem Forscher, dessen Stufenmodell des kreativen Prozesses wir gerade kennengelernt haben. Ich erreiche ihn in seinem Homeoffice, zwischen gigantischen selbst gebauten Regalen, die von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke reichen und mit Büchern gefüllt sind, die er sein ganzes Leben lang gesammelt hat – seine große Leidenschaft, wie er erzählt. An den Regalen entlang gleitet eine drei Meter hohe Leiter, damit man an die Bücher in den oberen Regalen kommt.
Runco betont zwei notwendige Voraussetzungen für Kreativität, an denen es uns in der heutigen Arbeitswelt mangelt:
ausreichend Zeit sowie
Toleranz gegenüber neuen und originellen Ideen und Verhaltensweisen
Zeit ist im kreativen Prozess eine wichtige Ressource, denn originelle Ideen finden sich oft weit entfernt vom ursprünglichen Problem oder der ursprünglichen Idee. „Diese Entfernung erfordert Zeit“, so Runco. „Es braucht Zeit, um von einer Idee zur nächsten zu gelangen.“ Das gilt vor allem für die Inkubationsphase des kreativen Prozesses. „Viele bemerkenswerte schöpferische Leistungen, zum Beispiel Darwins Evolutionstheorie, scheinen anhaltende Anstrengungen erfordert zu haben. Eine schöpferische Erkenntnis ist kein schnelles Aha!, sondern ein langwieriger Prozess.“ Genau diese Zutat aber fehlt im verdichteten und komplett durchgetakteten Arbeitsalltag der digitalen Kollaboration: Zeit, sich für eine Weile ausdrücklich nicht mit einer Aufgabe zu beschäftigen, sodass das Unterbewusstsein an kreativen Neukombinationen arbeiten kann.
Allen Lippenbekenntnissen zu mehr Vielfalt und Offenheit zum Trotz mangele es vielen Organisationen heute zudem an Toleranz gegenüber neuen, originellen Ideen und Verhaltensweisen: „Diese Art von Toleranz ist für Unternehmen und insbesondere für Führungskräfte aber enorm wichtig“, so Runco, „weil Kreativität bedeutet, dass der oder die Einzelne originell sein darf.“ Originalität ist keine hinreichende Voraussetzung für Kreativität, aber eine notwendige. „Wenn wir Kreativität wollen, müssen wir erkennen, dass originelle Dinge neu sind, und das bedeutet, dass man sie nicht erwartet. Sie sind unvorhersehbar.“
Klingt trivial, wird aus Sicht des Kreativitätsforschers aber zum Problem, weil er in vielen Organisationen einen Trend zu Vorhersehbarkeit und Routine beobachtet. Sowie – was Runco am gefährlichsten findet – zur Rechenschaftspflicht. Die Überbetonung von Kennzahlen und objektiver Messbarkeit führt zu einer Kultur der Reportings und Zielvereinbarungen. Abweichendes, ungeplantes oder gar irrationales Verhalten hat da keinen Platz.
Diese Fixierung auf Effizienzdenken ist für Runco ein Irrweg, vor allem in der Führung: „Vorgesetzte verstehen oft nicht, dass es keinen direkten Weg zur Kreativität gibt.“ Neues in die Welt zu bringen erfordere „Divergenz, Abweichungen, wilde und verrückte Ideen“. Auch ein Kreativitätsforscher weiß natürlich, dass Vorhersehbarkeit und Routinen gerade in Unternehmen notwendig sind – aber eben in Grenzen. „Messbarkeit und Rechenschaftspflicht können hilfreich sein“, sagt Runco zum Abschied: „Aber sie sind eindeutig nicht gut für die Kreativität.“
Ein Gastbeitrag und Auszug aus Markus Albers neuem Buch. Albers beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Veränderung der Arbeitswelt. In seinem neuen Buch „Die Optimierungslüge“ kritisiert er, dass Tools und Prozesse einen Großteil unseres Arbeitstages übernommen haben, was uns weniger produktiv, weniger kreativ und unglücklich macht. Und er zeigt Auswege aus diesem Dilemma.